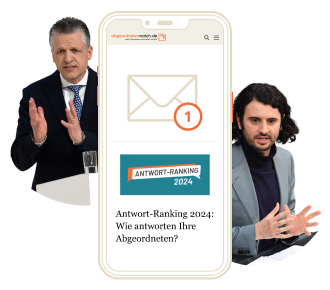Eigentlich sollte an diesem Dienstag im EU-Rat über eine verpflichtende Sperrklausel zwischen 2 und 5 Prozent ab der übernächsten Europawahl abgestimmt werden, doch dann kam alles ganz anders. Wegen des massiven Widerstandes von Belgien, vor allem der flämischen Regierungspartei N-VA, vertagte das Gremium die Schlussabstimmung.
Bisher kann jedes Land frei entscheiden, ob und welche Hürde es anwendet, solange die 5 Prozent nicht überschritten werden. Manche Länder haben dementsprechend eine Sperrklausel, andere nicht. Die neue verpflichtende Klausel soll künftig für alle größeren EU-Länder gelten, die mehr als 35 Abgeordnete ins Parlament entsenden, darunter auch Deutschland mit derzeit 96 Sitzen.
Piratenpartei prüft rechtliche Schritte
In Deutschland regt sich Widerstand der kleineren Parteien gegen die Wiedereinführung einer Sperrklausel, die u.a. von der Bundesregierung vorangetrieben wird. Millionen Wählerstimmen würden durch die Regelung unter den Tisch fallen, kritisiert zum Beispiel die Piratenpartei, die derzeit mit einer Abgeordneten im Europaparlament vertreten ist. „Wir prüfen rechtliche Schritte gegen diesen Angriff auf unser Grundgesetz und den Wählerwillen, insbesondere einen Antrag auf einstweilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts“, erklärte der Bundesvorsitzende der Piraten, Carsten Sawosch. Der Europaabgeordnete der Partei Die Partei, Martin Sonneborn, kommentierte das Vorhaben bei Twitter wie folgt: „Für Militäreinsätze, gegen GG, Kleinparteien & Demokratie!“ Belgien sei das einzige Land, „das die deutsche Forderung nach einer Sperrklausel zur EU-Wahl 2019 (noch) blockiert“. Die Stimme Belgiens ist entscheidend, da der Beschluss einstimmig erfolgen muss.
[Keine Recherche mehr verpassen: Hier können Sie sich in den kostenlosen abgeordnetenwatch.de-Newsletter eintragen]
Sperrklauseln wie die zur Europawahl oder die bestehende Fünf-Prozent-Hürde auf Bundesebene sind seit langem Gegenstand der öffentlichen Diskussion. Kritiker halten sie für undemokratisch, da so bei der Mandatsverteilung die Stimmen von Millionen Wählerinnen und Wählern unberücksichtigt bleiben können. Befürworter halten Sperrklauseln für notwendig, um einer Unregierbarkeit durch Parteienzersplitterung entgegenzuwirken.
Bundesverfassungsgerichte kippte 2014 die Drei-Prozent-Hürde
Das Bundesverfassungsgericht hat in den letzten Jahren gleich zweimal die hierzulande eingeführten Sperrklauseln zur Europawahl gekippt, zuletzt 2014. „Der mit der Drei-Prozent-Sperrklausel im Europawahlrecht verbundene schwerwiegende Eingriff in die Grundsätze der Wahlrechtsgleichheit und Chancengleichheit der politischen Parteien ist unter den gegebenen rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen nicht zu rechtfertigen“, schrieben die Richter damals in ihrem Urteil.
Aus Sicht der Bundesregierung braucht es eine Sperrklausel, um einer Zersplitterung des EU-Parlaments vorzubeugen. Das aber ist, zumindest was Deutschland angeht, wenig überzeugend: Von den sieben Abgeordneten kleinerer Parteien haben sich fünf einer Fraktion angeschlossen. So bildet Julia Reda, die für die Piratenpartei im Europaparlament sitzt, eine Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen. Ulrike Müller von den Freien Wählern ist Fraktionskollegin der FDP-Parlamentarier.
Das tatsächliche Interesse der Großen Koalition an einer Wiedereinführung der Sperrklausel dürfte ein anderes sein. Je weniger Parteien bei künftigen Europawahlen ins EU-Parlament einziehen, desto mehr Mandate entfallen auf die übrigen Parteien. Bei der vergangenen Wahl 2014 gingen insgesamt sieben Sitze an Parteien, die mit einer 3 Prozent-Hürde nicht im EU-Parlament vertreten gewesen wären (Die Partei, Familienpartei, Freie Wähler, NPD, ödp, Piratenpartei, Tierschutzpartei, für die mehr als 2 Mio. Wählerinnen und Wähler gestimmt hatten). In einem solchen Fall wären die Mandate nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel auf CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD, CSU oder FDP verteilt worden.
Anmerkung I: Nach einer kritischen Wortmeldung auf Twitter zur Bewertung der Sperrklausel haben wir den Text im dritten Absatz überarbeitet.
Anmerkung II: Nach der Vertagung der Schlussabstimmung im EU-Rat haben wir den Text entsprechend aktualisiert.